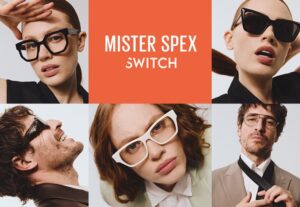Langenfeld (ots) –
Ein Multimilliarden-Erbe, ein verpasster Plan und die größte Erbschaftsteuerzahlung der deutschen Geschichte: Als der Münchener Industrielle Heinz Hermann Thiele im Februar 2021 überraschend verstarb, hinterließ er nicht nur ein Firmenimperium, sondern auch einen beispiellosen Steuerfall. Weil eine geplante Familienstiftung zu spät einsatzbereit war, musste die Familie Thiele fast 4 Milliarden Euro Erbschaftsteuer an den Fiskus abführen – eine Rekordsumme, die sonst wohl nie fällig geworden wäre.
Ein Fall, der zeigt, wie entscheidend Timing und Struktur bei der Vermögensnachfolge sind. Und einer, der nicht nur Juristen und Unternehmer interessiert – sondern alle, die glauben, mit einem Testament sei alles geregelt.
„Eine Stiftung kann enorme Steuervorteile bringen – aber nur, wenn sie rechtzeitig und rechtssicher aufgesetzt wird“, sagt renommierter Stiftungsexperte Sascha Drache. In diesem Beitrag erklärt er, wie Stiftungen zur legitimen Steueroptimierung beitragen können, worauf es bei der Gestaltung ankommt – und wie sich derartige Pannen mit der richtigen Strategie verhindern lassen.
1. Der Fall Thiele – Ein Lehrstück in Vermögensnachfolge
Heinz Hermann Thiele war kein gewöhnlicher Unternehmer. Aus einfachsten Verhältnissen arbeitete er sich zum Großaktionär und Aufsichtsratsvorsitzenden des Münchner Traditionskonzerns Knorr-Bremse hoch. Mit Beteiligungen an Vossloh und einer spektakulären Investition in die Lufthansa während der Corona-Krise baute er ein Firmenimperium im Wert von rund 15 Milliarden Euro auf – und wurde damit zum Multimilliardär.
Doch als Thiele im Februar 2021 überraschend stirbt, ist die geplante Familienstiftung, in die er seine Unternehmensanteile einbringen wollte, noch nicht rechtsfähig. Sein Wille war klar: Die Stiftung sollte die Kontrolle über das Familienvermögen sichern, Erbstreitigkeiten vermeiden – und enorme Erbschaftsteuer verhindern. Doch dieser Plan scheitert an einem entscheidenden Punkt: der Zeit.
Statt der Stiftung erbt zunächst seine zweite Ehefrau Nadia Thiele als sogenannte Vorerbin. Die testamentarische Konstruktion sieht zwar vor, dass die Vermögenswerte später an die Stiftung übergehen sollen – doch für das Finanzamt zählt nur der Stand zum Todeszeitpunkt. Und da war die Stiftung schlicht zu spät dran.
Es folgt ein erbitterter Rechtsstreit: Nadia Thiele weigert sich, die Stiftung wie vorgesehen umzusetzen, stellt das Stiftungskonzept ihres Mannes infrage – und scheitert damit mehrfach vor Gericht. Erst Ende 2024, fast vier Jahre nach dem Tod Thieles, einigen sich die Parteien auf einen Vergleich. Die Stiftung wird anerkannt und erhält die Unternehmensanteile. Doch die steuerliche Frist ist verpasst: Der Fiskus verlangt fast vier Milliarden Euro Erbschaftsteuer.
Ein Versäumnis, das vermeidbar gewesen wäre – und das eindrücklich zeigt, wie schnell sich komplexe Nachfolgepläne in Luft auflösen können, wenn ein einziger Schritt fehlt.
2. Wie hätte die Stiftung funktioniert?
Stiftungen gelten als das eleganteste Werkzeug, wenn es darum geht, große Vermögen über Generationen hinweg zu sichern – rechtlich stabil, steuerlich begünstigt, familiär befriedend. Genau deshalb greifen immer mehr Unternehmer zu diesem Instrument. Auch Heinz Hermann Thiele hatte dieses Ziel: Die geplante Familienstiftung sollte seine Firmenbeteiligungen dauerhaft bündeln, seine Tochter Julia als strategische Hüterin seines Lebenswerks einsetzen – und dabei dem Staat möglichst wenig überlassen.
Und tatsächlich: Wäre die Stiftung rechtzeitig gegründet und aktiviert worden, hätte sie die Erbschaftsteuerlast massiv reduzieren können. Das liegt an mehreren steuerlichen Sonderregeln:
– Erbersatzsteuer statt Erbschaftsteuer: Eine Stiftung „stirbt“ nicht. Deshalb wird die normale Erbschaftsteuer durch eine Erbersatzsteuer alle 30 Jahre ersetzt – planbar, ratenweise zahlbar, mit hohen Freibeträgen.
– Steuerklassenprivileg: Obwohl eine Stiftung keine „Verwandte“ ist, wird sie bei der Besteuerung so behandelt, als ob sie zwei Kinder beerbt – mit 800.000 Euro Freibetrag und günstigem Steuersatz.
– Verschonung von Betriebsvermögen: Bis zu 85 Prozent oder sogar 100 Prozent des unternehmerischen Vermögens können steuerfrei bleiben, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Eine Stiftung, die nur das Unternehmen hält, kann diese Hürden meist problemlos meistern.
– Keine Pflichtteilansprüche: Anders als bei einem Testament kann eine rechtzeitig errichtete Stiftung nicht angefochten werden. Neid, Streit und Klagen haben damit kaum eine juristische Angriffsfläche.
Doch all diese Vorteile gelten nur, wenn die Stiftung zu Lebzeiten aktiv ist. Wird sie erst nach dem Tod des Erblassers gegründet – oder wie im Fall Thiele erst Jahre später vollendet –, greifen die meisten steuerlichen Privilegien nicht mehr. Der Staat behandelt den Erbfall dann nach den üblichen Regeln – und das kann, wie hier geschehen, Milliarden kosten.
3. Warum scheiterte das Modell?
Auf dem Papier war Thieles Nachfolgeplan nahezu perfekt. Die Stiftung war gegründet, die Holdingstruktur eingerichtet, die Satzung formuliert. Und doch ging alles schief. Der Grund: Timing, juristische Feinheiten – und menschliche Konflikte.
Die Stiftung kam zu spät
Als Heinz Hermann Thiele starb, war die Stiftung zwar formal geplant, aber noch nicht als rechtsfähige juristische Person anerkannt. Damit war sie für das Finanzamt irrelevant. Der Nachlass fiel nicht an die Stiftung, sondern an die Ehefrau – mit allen steuerlichen Konsequenzen.
Die Bedürfnisprüfung scheiterte
Für sehr große Vermögen gelten strenge Regeln, damit Betriebsvermögen steuerlich begünstigt bleibt. Die sogenannte Bedarfsprüfung verlangt, dass der Erbe keine anderen Mittel zur Steuerzahlung hat. Doch bei Thiele war der Nachlass nicht sauber getrennt: Neben Unternehmensanteilen gab es Immobilien, Bargeld, Auslandsbeteiligungen – ein gemischter Nachlass, der die Steuerprivilegien verhinderte.
Die Konstruktion war steuerlich riskant
Die testamentarische Regelung sah vor, dass Nadia Thiele als Vorerbin alles erhält – mit der Pflicht, es später an die Stiftung weiterzugeben. Doch genau dieses Modell führte zur doppelten Steuerfalle: Erst musste Nadia Steuern zahlen – und bei ihrem Tod droht der Stiftung als Nacherbin ein zweiter Steuerzugriff, dann sogar mit dem höchsten Steuersatz.
Der Streit verschärfte alles
Anstatt die Stiftung wie vorgesehen umzusetzen, versuchte Nadia Thiele, Einfluss auf die Satzung zu nehmen, den Testamentsvollstrecker zu entlassen und ihren Einfluss auszubauen. Dadurch verzögerte sich die Umsetzung über Jahre – die Stiftung wurde erst 2023 anerkannt, die Unternehmensanteile erst Ende 2024 übertragen. Zu spät für eine steuerlich wirksame Gestaltung.
Am Ende zahlte die Familie – und der Staat profitierte
Im April 2025 gingen schließlich rund 4 Milliarden Euro Erbschaftsteuer an das bayerische Finanzamt. Geld, das vermeidbar gewesen wäre – wäre die Stiftung zu Lebzeiten des Erblassers aktiviert und das Modell konsequent umgesetzt worden.
4. Fazit: Die eine Lektion für alle, die Vermögen hinterlassen wollen
Der Fall Thiele ist kein Einzelfall – sondern ein Symbol. Er zeigt, was auf dem Spiel steht, wenn Vermögen in Milliardenhöhe vererbt wird. Aber er zeigt auch, dass es nicht Reichtum allein ist, der schützt, sondern Weitsicht, Struktur und Konsequenz.
Eine Familienstiftung kann ein mächtiges Instrument sein: Sie schützt das Lebenswerk, verhindert Erbstreitigkeiten, bietet steuerliche Vorteile und schafft generationsübergreifende Stabilität. Doch all das funktioniert nur, wenn sie rechtzeitig gegründet und mit Leben gefüllt wird.
Thieles Plan war klug – aber zu spät. Ein Irrtum, der selbst erfahrene Unternehmer treffen kann. Die Botschaft an alle, die Verantwortung für ihr Vermögen tragen, ist daher klar:
– Planung ist Pflicht.
– Zeit ist kostbar.
– Umsetzung ist entscheidend.
Denn am Ende ist es nicht der Staat, der gierig zugreift – sondern oft der Mensch selbst, der zu spät loslässt.
Über Sascha Drache:
Sascha Drache ist Experte für das Stiftungswesen. Er ist seit vielen Jahren in der deutschen Stiftungswelt unterwegs und gilt gemeinhin als der deutsche Stiftungspapst. Mit seiner Beratung in Sachen Stiftungsgründung unterstützt er den deutschen Mittelstand. Dabei begleitet der Experte seine Klienten über die gesamte Phase der Gründung und unterstützt sie dabei, die Stiftung auf einem festen Fundament zu errichten, um den Aufbau und Schutz des Vermögens langfristig sicherzustellen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.stiftung.de/
Pressekontakt:
Ratgeber Stiftung
Inhaber: Sascha Drache
https://www.stiftung.de
E-Mail: [email protected] Schäfer
[email protected]
Original-Content von: Ratgeber Stiftung, übermittelt durch news aktuell
Quelle: ots